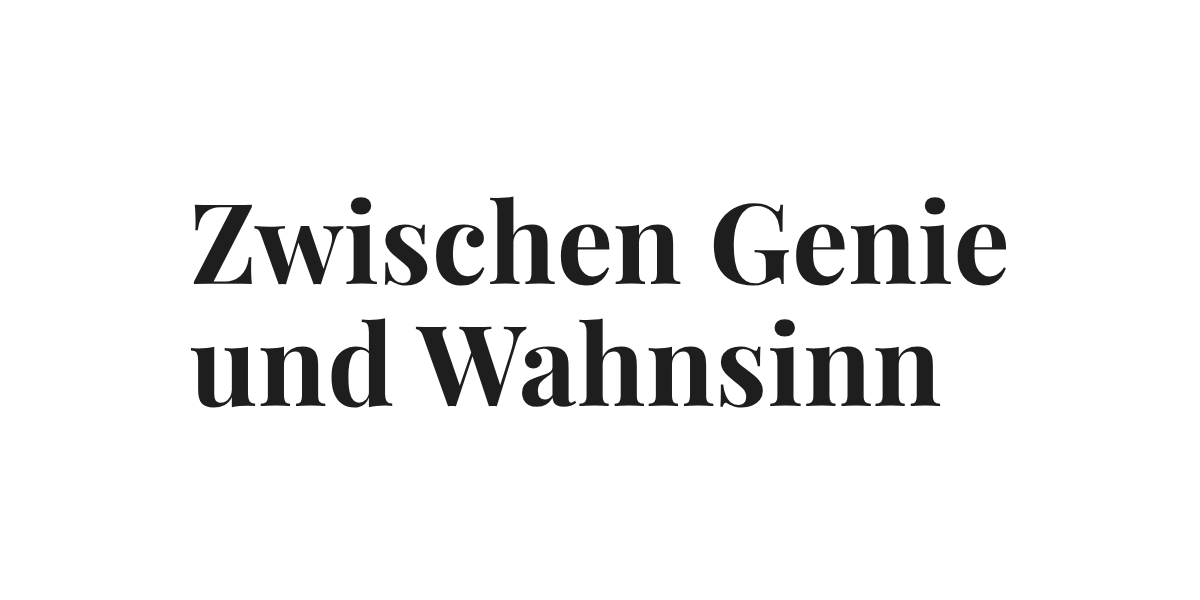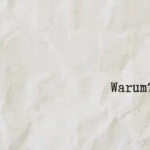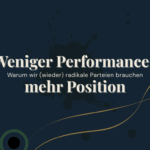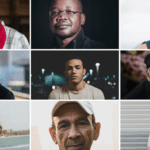Letztens bin ich auf eine Diskussion gestoßen – ich glaube, es war auf Instagram -, in der es darum ging, den Migrationsanteil in Schulklassen zu begrenzen – also eine Migrationsquote einzuführen.
So wie ich es verstanden habe, fordern bestimmte Politiker:innen, dass der Anteil von Schüler:innen mit Migrationshintergrund in Klassen nicht „zu hoch“ sein dürfe.
Mein erster Gedanke:
Was für ein Quatsch.
Wie so oft versucht man, ein komplexes gesellschaftliches Thema mit einer simplen Formel zu lösen.
Oder besser gesagt:
Es wird gar nichts gelöst – es wird nur behauptet, man „müsse etwas tun“.
Und das Ganze hat – für mich – ein unangenehmes Geschmäckle:
Nach Ausgrenzung. Nach Fremdenfeindlichkeit. Nach politischem Schein-Aktionismus.
Deshalb schreibe ich diesen Text.
Ich untersuche das, was scheinbar im Vordergrund steht – und schaue auf das, was aus meiner Sicht dahinterliegt.
Was ich schreibe, ist natürlich mein subjektiver Blick auf die Dinge.
Viel Freude beim Mitdenken und Selbstdenken.
🧭 Überblick
Eine Einladung, genauer hinzusehen – jenseits von Schlagzeilen und Scheinlösungen.
Titel: Debatte um Migrationsquote: Was Kinder wirklich brauchen
Kategorie: Integration & Gesellschaft
Schlüsselthemen: Integration, Migrationsquote, Bildung, Kinder, Gesellschaft, Verantwortung
Zentrale These:
Die Diskussion um Migrationsquoten in Schulen verfehlt das eigentliche Thema:
Integration gelingt nicht durch Sortierung, sondern durch Beziehung, Systemwandel und echte Chancengerechtigkeit.
Lesedauer: ca. 6 Min.
Worum geht es eigentlich in der Debatte?
Ausgangspunkt der Diskussion ist, dass es in manchen Schulen – vor allem in Städten – Klassen mit einem sehr hohen Anteil an Kindern mit Migrationsgeschichte gibt.
Manche sprechen von bis zu 70 %.
Das Argument:
Solche Konzentrationen würden die Leistungen schwächen – vor allem im sprachlichenn Bereich –
und Integration erschweren.
Karin Prien (CDU), Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, brachte die Idee einer Obergrenze ins Spiel.
Sie hält es für „denkbar“, den Anteil an Schüler:innen mit Migrationshintergrund pro Klasse zu begrenzen – und verweist auf Länder wie Kanada.
Ihr Ziel: Chancengleichheit, weniger Segregation, bessere Sprachförderung.
Auch Ahmad Mansour, Psychologe und Integrationsexperte, begrüßte den Vorschlag – als „Jahrhundertaufgabe“.
Integration brauche Struktur, sagte er, und gezielte Maßnahmen.
Warum das für mich nach Pseudodiskurs klingt
Klingt auf den ersten Blick nachvollziehbar.
Aber schauen wir mal genauer hin.
Müsste es nicht eigentlich darum gehen, die bestehenden Strukturen zu verbessern,
statt Schüler:innen mit Migrationshintergrund umzuschichten wie Spielfiguren?
Auf welcher Grundlage sollen solche Quoten überhaupt beruhen?
Und wie wird „Migrationshintergrund“ eigentlich definiert?
Wer zählt mit? Wer zählt nicht?
Wo fängt Zugehörigkeit an – und wer entscheidet darüber?
Und vor allem:
Was sagt das über unser Menschenbild?
Wenn Kinder nicht in eine Schule dürfen, weil andere Kinder mit ähnlichem Nachnamen oder ähnlicher Hautfarbe schon dort sind –
dann ist das keine Integrationsmaßnahme.
Das ist Ausgrenzung.
Verpackt in Verwaltungsdeutsch.
Was wäre, wenn…
…wir stattdessen darüber nachdenken würden, was Integration wirklich bedeutet – und was sie braucht?
Wenn uns klar würde,
dass die bestehenden Strukturen dem Thema längst nicht gerecht werden.
Dass das Umsortieren von Kindern nichts löst –
sondern bestenfalls den Anschein von Handlung erzeugt.
Wie funktioniert Integration wirklich?
Das ist doch die Frage.
Was wäre, wenn wir nicht Kinder zählen,
sondern Bedingungen verändern?
Was wäre, wenn wir das Schulsystem grundsätzlich infrage stellen würden?
Denn ganz ehrlich:
Auch für viele deutschstämmige Kinder passt es längst nicht mehr.
Es geht nicht darum, wer wo geboren ist.
Es geht darum, was Kinder brauchen.
Und das ist nie gleich – aber immer wichtig.
Gedanken zum Schluss
Ich glaube: Diese Debatte ist nur ein Symptom.
Ein Symptom dafür, dass niemand dem Thema Integration wirklich Aufmerksamkeit und Ressourcen schenken will.
Dass eine tiefere Angst herrscht – die Angst davor, wirklich etwas verändern zu müssen.
Eine Veränderung, die dem endlich Rechnung tragen würde,
dass wir ein Einwanderungsland sind.
Was wäre, wenn wir uns dazu einfach mal bekennen würden –
mit allen Konsequenzen?
Und nein,
die Konsequenz heißt nicht, dass wir weniger deutsch werden.
Darüber schreibe ich in einem anderen Artikel.
Die Konsequenz heißt:
Wir stellen uns der Realität.
Und der Verantwortung.
Wir heißen Menschen willkommen-
auch wenn sie kulturell anders sind.
Und wir hören auf, um das Thema herum zu lavieren.
Wir brauchen keine Migrationsquote in Schulen.
Wir brauchen ein kindergerechtes Schulsystem.
Eines, das verschiedenen Bedürfnissen gerecht wird.
Wir brauchen Veränderung.
Und ja –
das ist wohl das Schwierigste einzusehen.
Aber es ist das Einzige, was wirklich Wirkung zeigt.
Es ist der unbequeme Weg – aber der notwendige.
Was könnte ein erster Schritt sein?
Zu verstehen, was Integration wirklich bedeutet.
Und was sie wirklich braucht.
Und darüber hinaus:
Was Kinder eigentlich brauchen –
alle Kinder.
FAQ – Fragen & Antworten zur Debatte um die Migrationsquote in Schulen
Was bedeutet Migrationsquote überhaupt?
Eine Migrationsquote würde den Anteil von Schüler:innen mit Migrationshintergrund in einer Klasse oder Schule begrenzen. Sie basiert auf der Annahme, dass zu viele Kinder mit nicht-deutscher Herkunftssprache den Unterrichtsfortschritt hemmen könnten – eine Annahme, die empirisch höchst umstritten ist.
Wäre eine Obergrenze für Migrationsanteile sinnvoll?
Aus pädagogischer Sicht: nein. Kinder lernen voneinander – sprachlich, sozial, kulturell. Eine künstliche Trennung schafft kein besseres Lernen, sondern subtilen Ausschluss.
Was brauchen Kinder wirklich?
Beziehung. Sicherheit. Verständnis.
Lehrer:innen, die Zeit haben. Schulen, die Vielfalt als Ressource begreifen. Und Erwachsene, die zuhören, statt zählen.
👉 Hier wirst Du bald mehr lesen:
Was heißt eigentlich Integration? – über Zugehörigkeit, Identität und das, was uns verbindet.
Wie kann Integration praktisch gelingen? – über die kleinen Schritte, die Großes verändern.
💬 Dein Gedanke zählt.
Zwischen Genie & Wahnsinn ist ein freies Denklabor – offen für Menschen, die denken, fühlen und Wandel mitgestalten wollen.
Wenn Du etwas zu diesem Thema beitragen möchtest, eine eigene Perspektive teilen oder eine Gaststimme vorschlagen willst, schreib mir gern über den Contribute-Button.Oder teile Deine Gedanken direkt unten in den Kommentaren.Gemeinsam denken wir weiter.